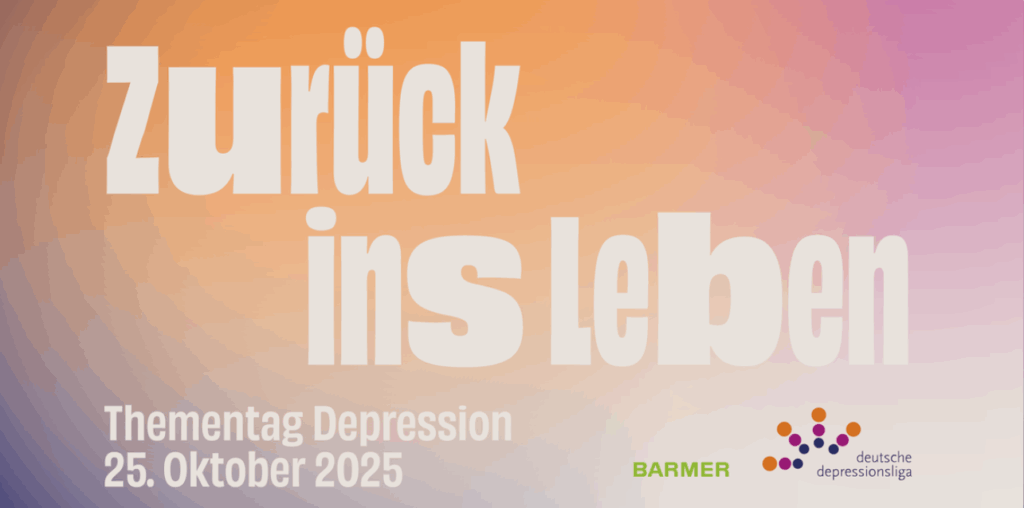Beschreibung der Folge
Ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn – so erklären vieleMenschen die Ursache einer Depression. In Deutschland leiden fast 10 Millionen darunter. Doch stimmt das überhaupt? Der Therapeut und Autor Thorsten Padberg formuliert es anders: „Knapp 10 Millionen Menschen erfüllen die Diagnosekriterien einer Depression. “ Wie präzise und plausibel diese Kriterien sind, bleibt ebenso umstritten wie die Behandlung mit Medikamenten. Die Wirkung von Antidepressiva steht in der Kritik. Padberg bemängelt, dass unsere Gesellschaft zu schnell Diagnosen stellt und Medikamente verschreibt. Das birgtRisiken: Einerseits geraten die wahren Ursachen – Verluste, Einsamkeit, soziale Ungleichheit und prekäre Lebensumstände – aus dem Blick. Andererseits reduzieren Menschen ihr Leben auf eine Diagnose, hinter der sie verschwinden. Padberg warnt vor der „Depressionsfalle“: Wer glaubt, allein die Biologie sei schuld, fühlt sich machtlos und verpasst die Chance auf echte Veränderung.
Depression ist kein reines Hirnproblem. Sie ist oft einSignal an uns alle: Wir brauchen mehr Unterstützung, stärkere soziale Netze, Gemeinschaft und echte Teilhabe, um Hoffnung und Lebensfreude zurückzugewinnen. Ein Gespräch über Therapie, psychiatrische Diagnosen,Depressionen namens „Karl-Heinz“, den Pharmamarkt, die Königin der Usambaraveilchen und die Frage, warum manche Mythen über Depression so hartnäckig bestehen bleiben.
Den Podcast finden Sie unter anderem auf Spotify
Rezension von DDL-Vorstandsmitglied Jürgen Leuther
Die Gedanken von Thorsten Padberg sprechen mir aus der Seele. Als Therapeut und ehemaliger Sozialarbeiter in der Psychiatrie habe ich unzählige Menschen erlebt, die von der „chemischen Ungleichgewicht“-These geprägt wurden – und damit in einer passiven, oft hilflosen Haltung verharrten. Diagnosen können entlasten, ja, aber sie reduzieren den Menschen auch schnell auf ein Etikett. Dahinter verschwinden Biografie, soziale Notlagen, Trauer und Einsamkeit.
Ich selbst habe eine schwere Depression durchlebt und weiß, wie sehr der Glaube an reine Biologie lähmen kann. Meine Genesung begann erst, als ich wieder Verbindungen knüpfte – zu Menschen, zu Sinn, zu kleinen Schritten im Alltag. Medikamente hatten ihren Platz, doch entscheidend war die Rückkehr ins Leben und das Gefühl, wieder gestalten zu können.
Padbergs Kritik am schnellen Verschreiben von Medikamenten und am gesellschaftlichen Umgang mit Depression ist daher hochrelevant. Wir dürfen Depression nicht als reines Hirnproblem missverstehen. Sie ist vielmehr ein Signal, das uns zwingt, die soziale und existentielle Dimension des Menschseins ernst zu nehmen.
Dieser Podcast und das dahinterstehende Buch ist ein notwendiger Anstoß für Fachleute wie Betroffene: Es fordert uns auf, Diagnosen kritisch zu hinterfragen und das Menschliche ins Zentrum zu rücken.